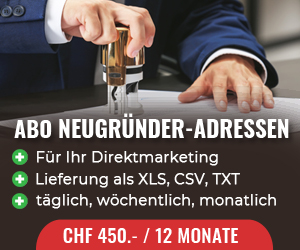Schweizerische Bundesbehörden: Leicht sinkende Treibhausgas-Emissionen aus der Schweizer Landwirtschaft |
| Tweet |

29.04.2014, Die Landwirtschaft ist eine wichtige Verursacherin von Treibhausgasen in der Schweiz. Besonders ins Gewicht fallen einerseits die Methan-Emissionen aus der Rindviehhaltung und der Lagerung von Hofdüngern. Anderseits trägt das Lachgas aus der Düngewirtschaft massgeblich zu den klimawirksamen Emissionen bei. Die Landwirtschaft stiess 2012 gegenüber dem Stand von 1990 rund neun Prozent weniger Treibhausgase aus.
Weniger Methan pro Liter Milch, effizienterer Düngereinsatz
Das Rindvieh nimmt eine besondere Stellung im Treibhausgasinventar der Landwirtschaft ein. Über 40 Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen stammen vom Methan-Ausstoss bei der Verdauung in den Mägen der Wiederkäuer. Die Viehwirtschaft ist über die Lagerung von Hofdünger und den Futterbau auch massgeblich an den Lachgasemissionen beteiligt. 44 Prozent der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen sind Lachgas, wobei sechs Prozent bei der Lagerung von Hofdüngern entstehen und 38 Prozent bei der Stickstoffumsetzung in Böden. Der Stickstoffumsatz erfolgt vor allem nach Einträgen von Mineral- und Hofdüngern sowie von Ernterückständen, durch symbiontische Stickstofffixierung und nach indirekter Stickstoffdeposition.
Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Emissionen folgt hauptsächlich der Entwicklung des Rindviehbestandes, der vor allem bis 2004 stark abgenommen hat und 2012 um rund 16 Prozent tiefer lag als 1990. Zwar stösst die einzelne Kuh wegen ihrer höheren Milchleistung heute im Durchschnitt mehr Methan aus als noch vor zwanzig Jahren. Da insgesamt aber mehr Milch mit weniger Kühen produziert wird, entsteht pro Liter Milch dennoch leicht weniger Methan als 1990. Auch im Pflanzenbau kann eine gewisse Entkoppelung der Emissionen von der Produktionsmenge beobachtet werden. Durch Effizienzsteigerungen im Pflanzenbau ist der Einsatz von Mineraldünger vor allem in den neunziger Jahren stark zurückgegangen. Dies führte zu deutlich weniger Lachgas-Emissionen.
Fragezeichen beim Kohlenstoff im Boden
Energetische Emissionen, zum Beispiel von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen, der Heizung von Gewächshäusern oder der Grastrocknung, werden dem Energiesektor zugeschlagen. Sie betragen rund 1.5 Prozent des nationalen Ausstosses und sind damit von weitaus geringerer Bedeutung als die Methan- und Lachgas-Emissionen.
Grösserer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Inventarisierung der Freisetzung respektive Bindung von Kohlendioxid in der organischen Substanz der landwirtschaftlichen Böden. Derzeit wird geschätzt, dass die landwirtschaftlichen Böden insgesamt eine relativ geringe Kohlendioxid-Quelle darstellen, in der Grössenordnung von einem Prozent der nationalen Treibhausgas-Emissionen. Es wird angenommen, dass sich die meisten mineralischen Böden diesbezüglich im Gleichgewicht befinden. Nur drainierte Moorböden verlieren Kohlenstoff in grösseren Mengen.
Die entsprechenden Emissionen werden im Sektor Landnutzung, Landnutzungswandel und Forstwirtschaft (LULUCF) ausgewiesen. Weil die Werte noch vereinfacht und mit grossen Unsicherheiten behaftet sind, werden sie bei der Zielerreichung des Kyoto-Protokolls nicht angerechnet. Laufende Forschungsarbeiten sollen die Grundlagen für eine verbesserte Berechnung liefern.
Produktion von Treibhausgasen im Ausland
Die rückläufigen Treibhausgas-Emissionen in der Schweizer Landwirtschaft geben kaum Grund zur Entwarnung. Erweitert man den Blickwinkel und betrachtet die gesamten Emissionen, die mit der menschlichen Ernährung in Zusammenhang stehen, zeigt sich seit 1990, analog zum Bevölkerungswachstum, eine steigende Tendenz: In der Schweiz machen so genannte „graue Treibhausgase" aus Importen von Produktions- und Nahrungsmitteln mehr als die Hälfte der ernährungsbedingten Emissionen aus. Letztere werden nicht im nationalen Inventar ausgewiesen und müssen separat erhoben werden.
Ein Bericht dazu soll diesen Herbst veröffentlicht werden. Laufende Projekte, beispielsweise im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 69 „Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion", werden weitere detailliertere Informationen liefern, auf deren Basis die Schweizer Agrar- und Ernährungspolitik weiterentwickelt werden kann.
In diesem Zusammenhang setzt die „Klimastrategie Landwirtschaft" des Bundesamtes für Landwirtschaft ehrgeizige Ziele. Bis 2050 soll die Schweizer Landwirtschaft ein Drittel der Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 durch technische, betriebliche und organisatorische Massnahmen reduzieren. Ein weiteres Drittel soll durch eine entsprechende Entwicklung der Konsum- und Produktionsmuster im Ernährungssektor eingespart werden. Entsprechend ihrer grossen Bedeutung für die Emissionen nehmen die Nutztierhaltung und der Konsum von tierischen Lebensmitteln eine zentrale Rolle ein.
Treibhausgasinventar der Schweizer Landwirtschaft
Agroscope berechnet jährlich die Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft in der Schweiz. Aufgrund von zahlreichen Forschungsergebnissen von Agroscope und anderen Forschungsinstitutionen werden die Berechnungsmodelle laufend an die landesspezifischen Verhältnisse angepasst, verfeinert und validiert. Neben der Quantifizierung der Emissionen sucht die Forschung auch nach Massnahmen und Strategien, mit welchen sich die Emissionen reduzieren lassen. Die Tatsache, dass in der Landwirtschaft zahlreiche Prozesse, die zu Treibhausgas-Emissionen führen, miteinander verknüpft sind, stellt die diversen Akteure dabei vor grosse Herausforderungen.
Medienkontakt:
Schweizerische Bundesbehörden Schweizerische Bundeskanzlei Bundeshaus West 3003 Bern BE Tel: 031 322 65 11
Über Schweizerische Bundesbehörden:
Sie umfasst sieben Departemente, die Bundeskanzlei sowie die dezentralisierten Verwaltungseinheiten und untersteht dem Bundesrat. Jedes Mitglied des Bundesrates steht einem Departement vor und trägt für dieses die politische Verantwortung. Die Bundesverwaltung beschäftigt rund 38'000 Personen. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin leitet die Bundeskanzlei.
Die Departemente heissen heute (seit 1979/98) Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Eidgenössisches Departement des Innern (EDI), Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), und Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).
Weitere Informationen und Links:
Newsletter abonnieren
Auf diesem Link abonnieren Sie unseren Newsletter und sind stets aktuell informiert.
Eigene News publizieren
Haben Sie eine aktuelle Firmeninformation oder ein Angebot, dass Sie hier publizieren möchten?
Auf diesem Link erfassen Sie die entsprechenden Informationen.