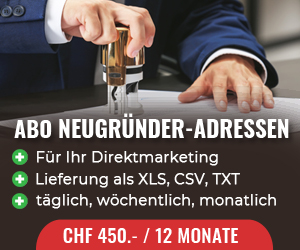BFS: Wie leben Familien in der Schweiz von heute? |
| Tweet |

12.05.2021, Haushalte mit Kindern unter 25 Jahren machen in der Schweiz knapp ein Drittel der Privathaushalte aus. Die grosse Mehrheit der Kinder lebt mit beiden Eltern zusammen. 13% leben in Einelternhaushalten und 6% in Patchworkfamilien. Obwohl Sozialtransfers die Armutsquote erheblich senken, befinden sich viele Einelternhaushalte in einer schwierigen Situation. Sie sind häufiger armutsgefährdet, auf Sozialhilfe angewiesen und mit ihrem Leben im Allgemeinen weniger zufrieden. Dies sind ausgewählte Ergebnisse aus dem statistischen Familienbericht 2021 des Bundesamtes für Statistik (BFS).
Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Paarhaushalten mit Kleinkindern weichen die Vorstellungen von der besten Aufteilung der Erwerbsarbeit und das tatsächliche Erwerbsmodell stark voneinander ab. 46% würden es bevorzugen, wenn beide Eltern Teilzeit erwerbstätig wären. In der Realität dominiert aber das Modell «Vater Vollzeit und Mutter Teilzeit», das von 49% der Paare mit Kindern unter vier Jahren gelebt wird. Nur bei 10% arbeiten beide Eltern Teilzeit.
Schweiz liegt bei Betreuung durch Grosseltern über europäischem Durchschnitt
In der Schweiz wird für gut ein Drittel der Kinder unter drei Jahren ein formelles Betreuungsangebot in Anspruch genommen. Dies entspricht dem europäischen Durchschnitt von 35%. Neben der formellen Betreuung in einer Kindertagesstätte oder durch eine in einem Netzwerk organisierte Tagesfamilie spielen auch andere Betreuungsformen eine wichtige Rolle: 40% der Kinder unter drei Jahren werden in der Schweiz ausschliesslich durch Grosseltern, andere Privatpersonen sowie unabhängige Tagesfamilien betreut oder nutzen diese Betreuungsform in Kombination mit einer formellen Betreuung. Im europäischen Durchschnitt sind es 28%.
Ein Fünftel der Einelternhaushalte sind auf Sozialhilfe angewiesen
Viele Einelternhaushalte haben eine angespannte Einkommenssituation: 23% haben Schwierigkeiten oder grosse Schwierigkeiten, finanziell über die Runden zu kommen, während es bei Paarhaushalten mit Kindern 13% und bei Paarhaushalten unter 65 Jahren ohne Kinder 7% sind. Einelternhaushalte sind – zusammen mit alleinlebenden Personen – besonders oft von Einkommensarmut betroffen. 21% werden von der Sozialhilfe unterstützt. Der Anteil ist damit deutlich höher als bei allen anderen Haushaltsformen. Für alleinlebende Eltern ist es oft schwierig, Familienpflichten und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen und der betreuende Elternteil (meistens die Mutter) kann oft nur eine eingeschränkte Erwerbstätigkeit ausüben. Dies kann nicht immer ausreichend über Alimente kompensiert werden.
Familiensituation hat grossen Einfluss auf Wohlbefinden
Die familiäre Situation und insbesondere das Bestehen einer Paarbeziehung hat auch einen grossen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Personen in Einelternhaushalten und alleinlebende Personen bezeichnen ihren allgemeinen Gesundheitszustand seltener als gut oder sehr gut (75% bzw. 78%) als Personen in Paarhaushalten mit Kindern (83%) und Personen in Paarhaushalten ohne Kinder (81%).
Zudem ist der Anteil der Einelternhaushalte und der alleinlebenden Personen unter 65 Jahren, die mit ihrem jetzigen Leben sehr zufrieden sind, mit 24% deutlich weniger hoch als jener der Personen in Paarhaushalten mit oder ohne Kinder (38% bzw. 41%). Das gilt gleichermassen für die Zufriedenheit mit den persönlichen Beziehungen und der Wohnsituation.
Informelle Unterstützung: ein wichtiges Element der Beziehungen zwischen den Generationen
18% der Personen im Alter von 25 bis 80 Jahren helfen mindestens einmal wöchentlich einer aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkten Person in ihrem Umfeld. Unabhängig vom Alter engagieren sich Frauen etwas häufiger als Männer (20% gegenüber 15%).
Für welche Personen die Unterstützung geleistet wird, hängt stark vom Alter ab. Die 25- bis 44- und die 45- bis 64-Jährigen unterstützen vor allem ihre kranken oder gebrechlichen Eltern oder Schwiegereltern (48% bzw. 65%). Bei den 65- bis 80-Jährigen verlieren die Eltern an Bedeutung, weil sie teilweise bereits verstorben sind. Die Hilfe kommt bei dieser Altersgruppe am häufigsten nicht verwandten Personen wie etwa Freunden oder Nachbarn zugute (42%).
Medienkontakt:
Andrea Mosimann
Sektion Demografie und Migration
Tel. +41 58 463 64 71,
E-Mail: andrea.mosimann@bfs.admin.ch
Über Bundesamt für Statistik BFS:
Diese Informationen dienen der Meinungsbildung in der Bevölkerung sowie der Planung und Steuerung von zentralen Politikbereichen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für einen modernen, demokratischen Staat.
Informationen werden in unserer zunehmend komplexen Welt immer zentraler - für die Orientierung, für den Entscheidungsprozess und für den planenden Blick in die Zukunft. Informationen prägen die Qualität der Handlungen. Bei Entscheiden haben statistische Informationen heute einen wichtigen Platz - sei es in der Politik (in Parlamenten, Exekutiven oder bei Abstimmungen), in der Wirtschaft oder im Alltag.
Statistik ist zu einem Transparenz-stiftenden Element in gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen geworden.
Weitere Informationen und Links:
Newsletter abonnieren
Auf diesem Link abonnieren Sie unseren Newsletter und sind stets aktuell informiert.
Eigene News publizieren
Haben Sie eine aktuelle Firmeninformation oder ein Angebot, dass Sie hier publizieren möchten?
Auf diesem Link erfassen Sie die entsprechenden Informationen.